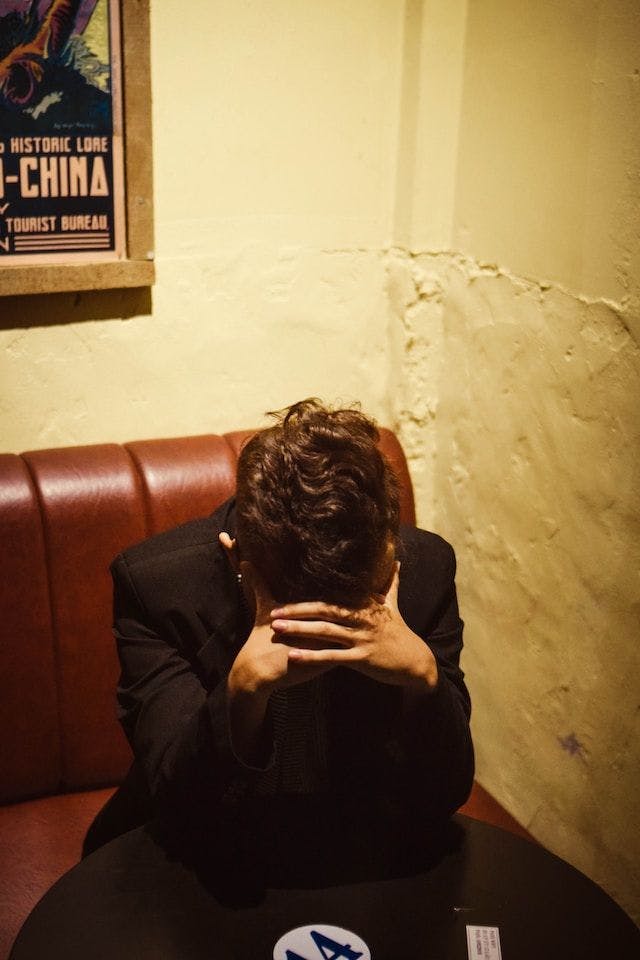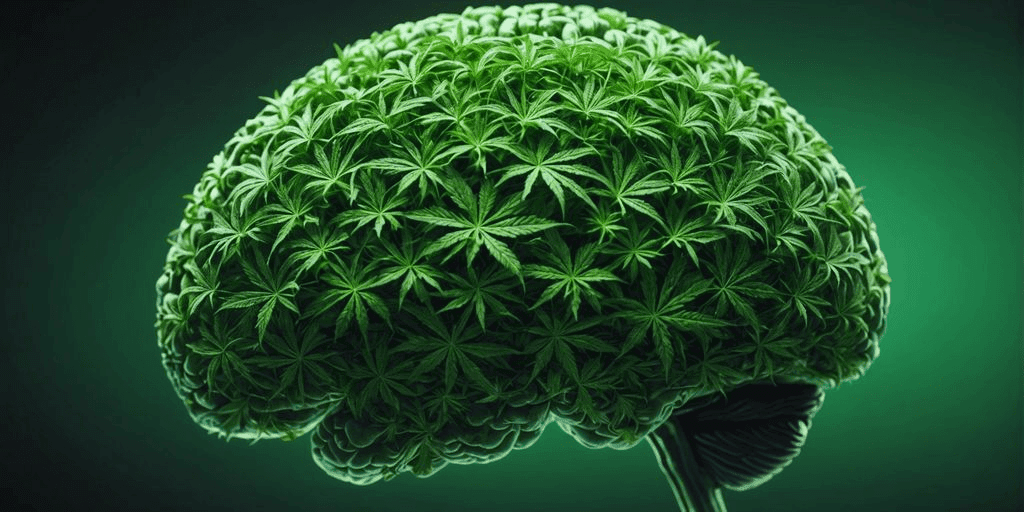Inhaltsverzeichnis
Wichtigste Erkenntnisse
- Laut Umfragen verwenden viele Cannabisnutzer die Pflanze nicht nur zum „Freizeitkonsum", sondern auch zur Selbstmedikation für verschiedene gesundheitliche Probleme
- Selbstmedikation entsteht häufig durch Versorgungslücken, Stigmatisierung und erschwerten Zugang zu regulärer medizinischer Cannabis-Therapie
- Die selbsttherapeutische Nutzung von Cannabis aus dem Schwarzmarkt oder Eigenanbau birgt erhebliche Risiken wegen fehlender Qualitätskontrolle, Dosierungsproblemen und Verunreinigungen
- Nutzer zur Selbstmedikation konsumieren oft intensiver, mit höherem Risiko für Nebenwirkungen, Abhängigkeit und psychische Probleme ohne ärztliche Begleitung
- Die Teillegalisierung 2024 könnte den Zugang zur ärztlich begleiteten Cannabis-Therapie verbessern, die für sichere und wirksame Behandlung entscheidend ist
Was, wenn wir Cannabis-Konsum jahrzehntelang falsch interpretiert haben? Während Politik und Gesellschaft von 'Kiffern' und 'Missbrauch' sprechen, zeichnen wissenschaftliche Studien ein anderes Bild. Befragungen weisen darauf hin, dass ein erheblicher Anteil von Cannabisnutzern die Pflanze teilweise oder überwiegend zur Selbstmedikation verwendet, häufig auch ohne sich dessen voll bewusst zu sein (1,2). Hinter dem vermeintlichen spaßorientierten „Drogenkonsum" und auch hinter vermeintlicher „Sucht" verbirgt sich ein massives Gesundheitsproblem.
Cannabis-Selbstmedikation ist in Deutschland ein weit verbreitetes, aber kaum diskutiertes Phänomen, das möglicherweise Millionen von Menschen betrifft. Während viele offiziell als "Freizeitkonsumenten" gelten oder auch abwertend als „Kiffer" bezeichnet werden, nutzen sie Cannabis teilweise oder auch überwiegend zur Behandlung verschiedener Beschwerden.
Warum greifen so viele Menschen zur Selbstmedikation statt einen Arzt aufzusuchen? Welche Risiken gehen sie dabei ein? Und wie können Betroffene den Weg von der Selbstmedikation zur sicheren ärztlichen Begleitung finden? Diesen Fragen gehen wir in dem folgenden Artikel auf den Grund.
Was ist Cannabis-Selbstmedikation und wie verbreitet ist sie?
Cannabis-Selbstmedikation bezeichnet die eigenständige Verwendung von Cannabis zur Linderung körperlicher oder psychischer Beschwerden ohne ärztliche Verschreibung oder Begleitung. Dies kann bewusst oder unbewusst geschehen: Einige Cannabis-Nutzer suchen ganz bewusst nach therapeutischen Effekten, andere wiederum verwenden Cannabis möglicherweise auch für verschiedene therapeutische Zwecke, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein.
Wichtig:
Die eigenständige Anwendung ohne ärztliche Begleitung birgt erhebliche gesundheitliche Risiken und kann zu unerwünschten Wirkungen führen. Eine Selbstmedikation ist nicht empfohlen.

Laut der Studie „Cannabis and Me" verwendete etwa ein Drittel der befragten „Freizeitnutzer" Cannabis explizit zur Selbstmedikation, häufig in Verbindung mit psychischen Belastungen oder chronischem Schmerz (2). Diese Gruppe konsumierte durchschnittlich 10–17 Joints pro Woche, deutlich mehr als andere Nutzer ohne ärztliche Verschreibung.
Weitere Daten von Forschungen weisen auf folgende Aspekte hin:
- Der Anteil derjenigen, die Cannabis zur Selbstmedikation nutzen, unter regelmäßigen Konsumenten ist besonders hoch: Bei regelmäßigem Konsum lag die Wahrscheinlichkeit bei dem 4-Fachen, bei intensivem Konsum sogar beim über 30-Fachen gegenüber gelegentlichem Konsum (3).
- Neuere Erhebungen dokumentieren, dass verschiedene Konsumformen und -muster in Deutschland verbreitet sind (4).
- Diese Zahlen stellen die gesellschaftliche Wahrnehmung grundlegend in Frage: Menschen mit hohem Cannabiskonsum werden schnell als 'süchtig' oder 'maßlos' abgestempelt, doch die Daten zeigen, dass viele von ihnen möglicherweise keines von beidem sind.
Vielmehr könnte es sein, dass sie ganz einfach eine Form von Selbstmedikation betreiben. Was wir schnell als 'Missbrauch' bezeichnen, könnte in Wirklichkeit ein manchmal auch verzweifelter Versuch sein, unbehandelte Beschwerden zu lindern.
Warum nutzen Menschen Cannabis zur Selbstmedikation, statt sich um ein Rezept für medizinisches Cannabis zu bemühen?

Die Gründe für den Gebrauch der Selbstmedikation sind vielfältig und zeigen deutliche Versorgungslücken auf. Eine kanadische Studie aus Quebec (5) identifizierte folgende Hauptgründe für die Selbstmedikation statt des Zugangs zu medizinischem Cannabis:
- Mangelnde Information über Cannabis-Kliniken (52%)
- Komplexität des Verschreibungsprozesses (39%)
- Schlechte Zugänglichkeit und Versorgung von Cannabis-Kliniken (23%).
Weitere Hürden spezifisch in Deutschland
- Mangelnde Kenntnisse: Viele Menschen wissen zu wenig über den Einsatz und das therapeutische Potenzial von Cannabis. Zudem fehlen Kenntnisse über das Cannabisgesetz (CanG)
- Stigmatisierung: Viele Ärzte stehen Cannabis-Verschreibungen kritisch gegenüber; Auch Cannabis-Nutzer selbst haben Skrupel, mit ihrem Arzt oder anderen über ihren Marihuana Konsum zu sprechen
- Keine Kostenübernahme: Patienten berichten von großen Schwierigkeiten bei der Erstattung der Kosten durch Krankenkassen
- Bürokratische Hürden: Bis 2024 war noch ein BtM-Rezept für medizinisches Cannabis erforderlich
- Mangelnde ärztliche Expertise: Viele Mediziner fühlen sich aufgrund mangelnder Kenntnisse noch unsicher bei der Möglichkeit von Cannabis-Verschreibungen
Seit April 2024 hat sich die Situation durch die Teillegalisierung verändert (6). In diesem Zusammenhang bleibt es zu hoffen, dass die gesellschaftliche Stigmatisierung weiter zurück geht. Zudem bleibt zu hoffen, dass Ärzte durch zunehmende Erfahrungen mit Cannabis in der Therapie mehr bereit sind, Cannabis als therapeutische Option zu betrachten.
Für welche Beschwerden wird Cannabis zur Selbstbehandlung eingesetzt?

Die Studienlage zeigt, dass Menschen Cannabis bei verschiedenen Beschwerden eigenständig anwenden. Die Bandbreite ist vielfältig (17). Es ist wichtig zu betonen, dass eine Selbstmedikation nicht empfohlen wird und jede therapeutische Anwendung mit einem Arzt besprochen werden sollte.
Angststörungen
Eine groß angelegte Studie (7) zeigt, dass Angststörungen die häufigste genannte Indikation für Cannabis-Selbstmedikation darstellen.
Die wissenschaftliche Evidenzlage ist widersprüchlich: Während Stresslinderung und Angstreduktion die am häufigsten genannten Gründe für Cannabiskonsum sind, weisen einige Studien darauf hin, dass Cannabis sowohl anxiolytische (angstlösende) als auch anxiogene (angstauslösende) Eigenschaften haben kann (8).
Chronischer Stress
Chronischer Stress gehört zu den am häufigsten genannten Gründen für Cannabis-Selbstmedikation. Cannabis wird häufig als Stressbewältigungsstrategie genutzt, wobei negative Lebensereignisse, Trauma und schlecht angepasste Bewältigungsstrategien alle mit erhöhtem Konsum verbunden sind (9).
Die Nutzung von Cannabis zur Stressbewältigung ist besonders deutlich beim chronischen im Vergleich zum experimentellen Konsum. Stresslinderung, Entspannung und Angst-/Spannungsreduktion sind die am häufigsten genannten Gründe für Cannabiskonsum (8). Die wissenschaftliche Evidenz ist widersprüchlich und zeigt komplexe Effekte, die auch dosisbezogen unterschiedlich sind (10,11).
Schlafprobleme
Viele Menschen in Deutschland leiden unter Schlafproblemen und informieren sich über Cannabis bei Schlafproblemen. Einige Betroffene berichten von subjektiven Verbesserungen durch Cannabis-Nutzung. Trotz einiger positiver Hinweise in Forschungstests im Labor und an Tieren ist die wissenschaftliche Evidenz zur langfristigen Wirksamkeit und Sicherheit beim Menschen jedoch begrenzt (12).
Chronische Schmerzen
Sehr viele Menschen nutzen Cannabis bewusst oder unbewusst auch ohne Rezept, um mit ihren chronischen Schmerzen umzugehen.
Die wissenschaftliche Evidenz zur Wirksamkeit von Cannabis bei verschiedenen Schmerzarten ist heterogen und vom Schmerztyp abhängig.Eine individuelle ärztliche Einschätzung ist zwingend erforderlich.
ADHS-Symptomatik
Eine Studie von Stueber und Cuttler (2022) (13) dokumentierte Selbstberichte von Cannabis-Nutzern mit ADHS. Bisher gibt es zu diesem Thema kaum hochwertige Studien und die wissenschaftliche Evidenz aus kontrollierten Studien ist äußerst begrenzt.
Depression
Auch bei depressiven Verstimmungen greifen manche Menschen zur Selbstmedikation mit Cannabis.
Kontrollierte Studien zeigen bisher keine relevante Evidenz für eine Wirksamkeit von Cannabis bei Depressionen. Einige Beobachtungsdaten aus der medizinischen Praxis deuten auf mögliche Effekte hin (14), jedoch ist die wissenschaftliche Datenlage unzureichend.
Es muss betont werden, dass Cannabis bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen die Symptomatik verschlechtern kann und auf keinen Fall ohne ärztliche Begleitung angewendet werden sollte. Sprechen Sie mit einem Arzt über geeignete Behandlungsmöglichkeiten bei Depression.
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
PTBS stellt einen bedeutenden Grund für Cannabis-Selbstmedikation dar. In einer Studie einer PTSD-Spezialklinik für Kriegsveteranen zeigte sich, dass Cannabiskonsum bei Veteranen mit PTBS mit höheren Schweregraden von Trauma- und Stimmungssymptomen assoziiert war, was die Selbstmedikationshypothese stützt (15).
Eine britische Untersuchung fand heraus, dass 77,7% der Patienten mit PTBS, die Cannabis zur Selbstmedikation nutzten, gleichzeitig eine komorbide Depression aufwiesen (16). Die Forschungslage zur Wirksamkeit von Cannabis bei PTBS ist gemischt und erfordert differenzierte Betrachtung (12), (18), (19).
Eine ärztliche Begleitung ist bei PTBS besonders wichtig, da das Risiko für problematischen Cannabiskonsum und Abhängigkeit in dieser Patientengruppe erhöht ist. Sprechen Sie mit einem Arzt über geeignete Behandlungsmöglichkeiten bei PTBS.
Wie unterscheidet sich Selbstmedikation von anderem Cannabiskonsum ohne Rezept?
Die Unterscheidung zwischen selbsttherapeutischer Nutzung und einer Nutzung für andere nicht-medizinische Zwecke ist oft fließend, aber Studien zeigen wichtige Unterschiede in den Konsummustern:
Selbstmedikation ist gekennzeichnet durch:
- Höhere Konsumfrequenz: Studien zeigen, dass Selbstmedikation besonders bei intensiveren Nutzern ausgeprägt ist (20). In der kanadischen Studie berichteten fast 46 % der selbsttherapeutischen Nutzer von täglichem Cannabiskonsum, während ca. 32 % wöchentlichen bis fast täglichen Konsum angaben (5). Die Mehrheit behandelte ihre Gesundheitsbeschwerden mit Cannabis für mehr als ein Jahr.
- Regelmäßige, kontrollierte Einnahme zu festen Zeiten
- Fokus auf Symptomlinderung statt Bewusstseinsveränderung
- Oft ausschließlich medizinische Nutzung (etwa 25% der Nutzer berichten von rein medizinischer Verwendung) (5)
- Spezifische Produktwahl: Selbsttherapeutische Nutzer wählen oft bestimmte Cannabinoid-Verhältnisse basierend auf ihren Symptomen
Bei anderen Konsumenten, die Cannabis weder auf Rezept noch in Eigeninitiative therapeutisch einsetzen, zeigen sich folgende Konsummuster:
- Unregelmäßige, situationsbedingte Nutzung
- Anstreben einer psychoaktiven Wirkung
- Soziale, hedonistische oder viele andere Motivationen
- Geringere Konsistenz in Produktwahl und Anwendung
- Personen, die Cannabis zur Selbstmedikation nutzen, zeigen höhere CUDIT-R-Scores (Cannabis Use Disorder Identification Test) und berichten häufiger von Entzugssymptomen (20).
Dies unterstreicht die Notwendigkeit ärztlicher Begleitung mit kontrollierten Cannabisprodukten, da ihre zumeist intensivere Nutzung mit höheren gesundheitlichen Risiken verbunden ist.
Welche Risiken birgt Cannabis-Selbstmedikation ohne ärztliche Begleitung?

Die Selbstmedikation ohne professionelle Begleitung ist mit erheblichen Risiken verbunden, hier sind einige Beispiele:
- Dosierungsprobleme: Ohne standardisierte Produkte und ärztliche Anleitung ist die richtige Dosierung und Menge schwer zu finden. Bei Selbstmedikation besteht die deutliche Gefahr, dass Betroffene beabsichtigt oder unbeabsichtigt psychoaktive Wirkungen hervorrufen, die zu Beeinträchtigungen im Alltag führen können.
- Qualitätsprobleme: Cannabis vom Schwarzmarkt oder aus Eigenanbau birgt erhebliche Risiken bezüglich der Qualität. Verunreinigungen, Schimmel oder synthetische Cannabinoide und Wirkstoffe können schwerwiegende Gesundheitsschäden verursachen.
- Psychische Risiken: Menschen, die Cannabis zur Bewältigung von Angstzuständen oder Depressionen nutzen, zeigen in Studien häufiger schwere Paranoia-Symptome. Regelmäßiger Konsum kann mit erhöhtem Risiko für psychotische Symptome, depressive Störungen und beeinträchtigte kognitive Leistungen verbunden sein.
- Abhängigkeitspotenzial: Die Nutzung von Cannabis kann zu einer Cannabiskonsumstörung führen. Besonders gefährdet sind Menschen mit impulsiven Verhaltensmustern oder emotionaler Labilität, vor allem aufgrund der Tendenz zur Selbstmedikation. Studien zeigen, dass selbsttherapierende Nutzer häufiger von Entzugssymptomen betroffen sind und höhere Raten problematischen Konsums aufweisen (20).
- Wechselwirkungen: Cannabis kann mit anderen Medikamenten Wechselwirkungen eingehen. Ohne ärztliche Kontrolle besteht das Risiko gefährlicher Wechselwirkungen oder einer Beeinträchtigung bestehender Therapien.
Welche legalen Alternativen gibt es zur Cannabis-Selbstmedikation?
Seit der Teillegalisierung 2024 haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für medizinisches Cannabis in Deutschland grundlegend verändert. Bereits seit 2017 können Ärzte in Deutschland Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen verschreiben. Mit dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes (CanG) im April 2024 wurde der Zugang jedoch weiter vereinfacht: Cannabis fällt seither nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz und benötigt kein BtM-Rezept mehr – ein normales Kassenrezept genügt.
Entscheidend ist, dass es keine festgelegten Indikationen gibt. Der behandelnde Arzt entscheidet eigenverantwortlich über die Verschreibung basierend auf seiner medizinischen Einschätzung. Voraussetzungen sind typischerweise das Vorhandensein einer schwerwiegenden Erkrankung und eine positive Nutzen-Risiko-Abwägung. Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen muss weiterhin beantragt werden und erfolgt nur bei schwerwiegenden Erkrankungen.
Telemedizinische Angebote ermöglichen eine erste ärztliche Beratung per Online-Sprechstunde, jedoch ist zu beachten, dass eine körperliche Untersuchung in der Telemedizin nur eingeschränkt erfolgen kann.
Fazit
Die hohe Zahl an Menschen, die sich selbst mit Cannabis behandeln, zeigt: Es besteht Handlungsbedarf. Das Gesundheitssystem benötigt bessere Schulungen für Ärzte zum Thema Cannabis, klarere Regeln bei der Kostenübernahme durch Krankenkassen und mehr spezialisierte Behandlungsangebote.
Cannabis-Selbstmedikation ist in Deutschland ein weitverbreitetes Phänomen, das möglicherweise viele Menschen betrifft. Die Forschungsdaten zeigen, dass viele Cannabisnutzer Cannabis zur Symptomlinderung einsetzen – oft ohne ärztliche Begleitung und mit erheblichen gesundheitlichen Risiken.
Die Teillegalisierung 2024 war ein Schritt, doch es braucht weiteren Fortschritt: verbesserten Zugang zu medizinischem Cannabis unter ärztlicher Aufsicht, eine gesellschaftliche Entstigmatisierung, flächendeckend hochwertige ärztliche Beratung und vor allem ein Gesundheitssystem, das die Bedürfnisse leidender Menschen ernst nimmt.
Wir sollten Menschen erreichen, die Cannabis zur Selbsttherapie nutzen. Viele wissen nicht, dass professionelle Hilfe verfügbar ist, oder scheuen den Gang zum Arzt aus Angst vor Stigmatisierung. Wenn du jemanden kennst – einen Freund, ein Familienmitglied, einen Kollegen – der Cannabis regelmäßig nutzt und bei dem du vermutest, dass eine therapeutische Begleitung helfen könnte: Teile diesen Artikel. Sprich das Thema behutsam an. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass aus versteckter Selbstmedikation eine offene, sichere und wirksame Behandlung wird.
Quellen
Barsch, G., Schmid, J.-S. (2018): Selbstinitiierte Behandlung und Selbstmedikation mit Phytocannabinoiden – Ergebnisse einer qualitativen Studie unter Cannabis-Medizin-Patienten. In: Die Naturheilkunde, 95. Jahrgang, Ausgabe 6/2018, Sonderdruck, S. 38–42. ISSN 1613-3943. Hochschule Merseburg.
- Spinazzola, E. u. a. (2025): Reasons for first using cannabis and their associations with mental health symptoms in current users. BMJ Mental Health 28(8), e301234.
- Manthey, J. u. a. (2023): Trends and projection in the proportion of (heavy) cannabis use in Germany from 1995 to 2021. Addiction 119(3), S. 519-529.
- Kastaun, S. u. a. (2024): Cannabis Use in Germany: Frequency, Routes of Administration, and Co-use of Inhaled Nicotine or Tobacco Products. Deutsches Ärzteblatt International 121(1), S. 1-8.
- Asselin, A. u. a. (2022): A description of self-medication with cannabis among adults with legal access to cannabis in Quebec, Canada. Journal of Cannabis Research 4(1), S. 26.
- Bundesgesundheitsministerium (2023): Auswirkungen der Legalisierung von Cannabis – Abschlussbericht und Studienübersicht.
- Leung J, u.a. (2022), Prevalence and self-reported reasons of cannabis use for medical purposes in USA and Canada. Psychopharmacology 239(5), S. 1509-1519.
- Stapleton, L. et al. (2014): Cannabis Use and Anxiety: Is Stress the Missing Piece of the Puzzle? Frontiers in Psychiatry, 5, 168.
- Hyman, S. M. & Sinha, R. (2009): Stress-Related Factors in Cannabis Use and Misuse: Implications for Prevention and Treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 36(4), 400-413. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsat.2008.08.005
- Nicholas C. Glodosky, u.a.(2021): A review of the effects of acute and chronic cannabinoid exposure on the stress response. Neuropharmacology 200, 108810.
- Peiper, N. C. u. a. (2020): Medicinal Marijuana, Stress, Anxiety, and Depression: Primum non nocere. Missouri Medicine 117(6), S. 495-498. PMID: 33311750
- O'Neil, M. E. u. a. (2017): Benefits and Harms of Plant-Based Cannabis for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review. Annals of Internal Medicine 167(5), S. 332-340. DOI: https://doi.org/10.7326/M17-0477
- Stueber, A. & Cuttler, C. (2022): Self-Reported Effects of Cannabis on ADHD Symptoms, ADHD Medication Side Effects, and ADHD-Related Executive Dysfunction. Journal of Attention Disorders 26(6), S. 942-955.
- Cuttler, C. u. a. (2018): A naturalistic examination of the perceived effects of cannabis on negative affect. Journal of Affective Disorders 235, S. 198-205. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.04.054
- Metrik, J. u. a. (2016): Prevalence and Correlates of Cannabis Use in an Outpatient VA Posttraumatic Stress Disorder Clinic. Psychology of Addictive Behaviors 30(3), S. 415-421. DOI: https://doi.org/10.1037/adb0000154
- Yland, J. u. a. (2024): Medicinal cannabis for treating post-traumatic stress disorder and comorbid depression: real-world evidence. BJPsych Open 10(2), e57. DOI: https://doi.org/10.1192/bjo.2024.16
- Boehnke, K. F. u. a. (2024): Factors associated with the use of cannabis for self-medication by adults: data from the French TEMPO cohort study. Journal of Cannabis Research 6(1), S. 15. DOI: https://doi.org/10.1186/s42238-024-00230-2
- Rehman, Y. u. a. (2021): Cannabis in the management of PTSD: a systematic review. AIMS Neuroscience 8(3), S. 414-434. DOI: https://doi.org/10.3934/Neuroscience.2021022
- Shalev, A. u. a. (2020): Cannabis and Complex Posttraumatic Stress Disorder: A Narrative Review With Considerations of Benefits and Harms. Journal of Clinical Psychiatry 81(4), 20r13334. DOI: https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000001172
- Wallis, D. u. a. (2022): Predicting Self-Medication with Cannabis in Young Adults with Hazardous Cannabis Use. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(3), 1850.